In der Unteren Lobau gilt es seit 2015 aufgrund einer mathematischen Modellierung als hochriskant, aus der Neuen Donau dringend benötigtes Wasser einzuspeisen. Würde man dies tun, so das Ergebnis dieser Modellierung, sei das Wasserwerk Lobau gefährdet und damit auch die Wasserversorgung der Wiener Bevölkerung.
In einem sozialen Medium wäre es an dieser Stelle angebracht den Hashtag #kopfschuettel anzufügen. Der Fortbestand des Nationalparks spielt in der Diskussion übrigens nur eine untergeordnete Rolle.
Es gab jedoch eine Zeit, in der man seltsamerweise dachte, mehr Wasser in der Unteren Lobau würde auch der Grundwassergewinnung guttun. Diese Zeit liegt mehr als 45 Jahre zurück.
GRUNDWASSERANREICHERUNG ALS HOFFNUNG
Schon Ende 1973 gibt die Stadt Voruntersuchungen zur „Grundwasseranreicherung“ in der Unteren Lobau in Auftrag. 1976 beauftragen die Wiener Wasserwerke eine Planungsgemeinschaft, die Möglichkeiten zu prüfen, aus der Unteren Lobau Grundwasser noch intensiver als bisher zu fördern. Weil die von den Wasserwerken damals erhoffte Einspeisung von Wasser aus der Alten oder der Neuen Donau in die Lobau noch auf sich warten ließ, kam man auf die Idee, das „natürlich“ einfließende Oberflächenwasser (Regen, Überschwemmung) möglichst aufzustauen.

Die Planungsgemeinschaft stellte anhand eines mathematischen Modells fest, dass durch einen „dotierten Aufstau des Kühwörtherwassers“ einerseits zusätzliches Grundwasser verfügbar sei, andererseits auch „die Grundwasserverhältnisse für die Aulandschaft weitgehend verbessert werden könnten.“
Dafür müsse man bei der Gänshaufentraverse lediglich eine Wehranlage errichten.
Der Aufstau würde auch im angrenzenden Fadenbach zu einer Anhebung des Wasserstandes führen. Auf die Grundwasserverhältnisse im Marchfeld hätte er keinerlei Auswirkungen.
Bedenken hatte man wegen möglicher Schadstoffe aus Industrieabwässern, die durch den Aufstau ins Grundwasser gelangen könnten. Um das Vorhaben gegebenenfalls frühzeitig zu stoppen, wurden auf Vorschlag der Hygienisch-bakteriologischen Bundesversuchsanstalt die Brunnen während des Versuches täglich auf Verunreinigungen untersucht.
FINANZIERT UND GENEHMIGT
1980 genehmigte der Wiener Gemeinderat für den Aufstau des Kühwörtherwassers in der Unteren Lobau einen Sachkredit in der Höhe von 5,5 Millionen Schilling (heute 1,24 Millionen Euro).
SPÖ-Gemeinderat Rudolf Freinberger betonte, dass die Maßnahmen im Interesse einer gesicherten Wasserversorgung und der Lobau als Naturschutz- und Naherholungsgebiet sehr wichtig seien. ÖVP-Gemeinderat Wolfgang Strunz bezeichnete das Projekt als interessant, für die Lobau sehr wichtig, und auch für die künftige Wasserversorgung von Bedeutung.
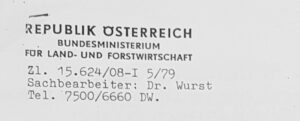 Die Oberste Wasserrechtsbehörde im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft erteilte die Bewilligung.
Die Oberste Wasserrechtsbehörde im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft erteilte die Bewilligung.
So wurde im Winter 1980/81 „zur Verbesserung der Zuströmverhältnisse zu den Grundwassergewinnungsanlagen“ an der Gänshaufentraverse eine im wesentlichen fixe Wehranlage errichtet, die nur eine minimale Steuerung der Wasserspiegel zuließ.
Wurden durch den Aufstau des Kühwörtherwassers die Brunnen nun bereichert oder gefährdet? Welche Auswirkungen hatte dieser streng kontrollierte wasserwirtschaftliche Versuch auf das Grundwasserwerk Lobau?
DAS ERGEBNIS
Oberstadtbaurat DI Roland Leiner von den Wiener Wasserwerken fasst 1992 das Ergebnis des praktischen Versuches in einem einzigen Satz zusammen: „Es zeigte sich allerdings, dass kaum mehr Wasser zur Gewinnung zur Verfügung stand, obwohl der Aufstau relativ lange blieb.“
Was war damals anders als heute? Es war die Art und Weise, wie in der Stadt Erkenntnisse gewonnen und Handlungen gesetzt werden:
1980 stellte eine mathematische Modellierung ein bestimmtes Ergebnis in Aussicht: Wasser aufstauen = mehr Wasser für die Brunnen. Die Stadt beschloss, dies in der Praxis zu überprüfen. Hygienische Bedenken wurden berücksichtigt und diesbezüglich Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Die Oberste Wasserrechtsbehörde gab ihren Sanktus. Ergebnis: Die mathematische Modellierung lag daneben.
Auch 2015 stellte eine mathematische Modellierung ein bestimmtes Ergebnis in Aussicht: Wasser einspeisen = Gefährdung der Brunnen. Die Stadt beschloss, dies nicht in der Praxis zu überprüfen. Hygienische Bedenken wurden zur “Gefährdung der Wiener Wasserversorgung” hochdramatisiert. Die Genehmigung der Obersten Wasserrechtsbehörde wird als schwer zu überwindende Hürde dargestellt. Ob die mathematische Modellierung daneben lag, weiß deshalb bis heute kein Mensch. Die Lobau geht somit seit zehn Jahren aufgrund verweigerter Hilfeleistung durch Verlandung und zeitweilige Austrocknung rascher als je zuvor zugrunde.
Fotos (Kühwörtherwasser 1980): Manfred Christ
Quellen:
- DonauConsult IB GmbH (2023): Ausgangslage, Ist-Zustand und Zielsetzung. In: Untere Lobau Gänshaufentraverse Betriebsordnung 2023. Auftraggeber: Stadt Wien – Wiener Gewässer
- MA 45 Wiener Gewässer (2015): Endbericht Gewässervernetzung (Neue) Donau – Untere Lobau (Nationalpark Donau-Auen)
- Leiner, Roland (1992): Trinkwassergewinnung und Trinkwasserqualität in der Lobau. In: Expertengespräch Donau-Grundwasser-Trinkwasser in der Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal am 2. Juni 1992
- Magistrat der Stadt Wien (1982): Die Verwaltung der Stadt Wien 1981 (S. 213)
- N.N. (1980): Stauversuch „Kühwörther Wasser“. In: Rathauskorrespondenz, 30.5.1980
- N.N. (1980): Aufstauversuch Kühwörther Wasser. In: Rathauskorrespondenz, 23.5.1980
- Bescheid des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft (1980): Grundwasserwerk Untere Lobau, projektierte Grundwasseranreicherung Lobau, hydrologische Voruntersuchungen, Aufstauversuche Kühwörtherwasser, wasserrechtliche Bewilligung (Zl. 15.624/08-I 5/79 vom 10.1.1980)
- N.N. (1973): Suche nach neuen Wasservorräten. In: Rathauskorrespondenz, 22.11.1973


